 |
| |
Mai 2005
Das wilde Kind
Zum 60. Geburtstag von Rainer Werner Fassbinder – Splitter zu einem Porträt / Von Ralf Schenk
film-dienst 11/2005 |
I.
Die Nachricht von Fassbinders Tod (am 10. Juni 1982) kommt überraschend; im ersten Moment will sie niemand glauben. Dann Lähmung, Ratlosigkeit, Verzweiflung, Zorn. Die Trauer erfasst Freunde, Kollegen, Zuschauer, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern überall in der Welt. In der „Zeit“ schreibt ein Leser: „Fassbinder war für mich ein Stück geistige Heimat.“ Ästhetische und politische Kontrahenten bekunden ihre Wertschätzung; lehnen aber, wie Hans-Jürgen Syberberg, auch seine Verklärung zum Mythos ab: „Jetzt wird er zum lächerlichen Gartenzwerg ihres Selbstmitleids heroisiert.“ Einen der schönsten Texte verfasst der Schriftsteller Gerhard Zwerenz, der Fassbinder als Autor und gelegentlicher Kleindarsteller verbunden ist: „Es ist nie hinreichend über den Zusammenhang von Trostlosigkeit und Trotz nachgedacht worden“, resümiert Zwerenz. „Starke Naturen reagieren auf trostlose Zustände mit vermehrtem Trotz. Nimmt er die Gestalt von Werken an, die am Lauf der Welt nichts ändern, verwandeln sie sich zur Gänze selbst in eins ihrer Werke. Die deutsche Romantik wußte davon. Ihr schönes Lob des Todes entsprach der Einsicht in die Enge des Käfigs. Wer seine Fluchtphantasien stark genug werden lässt, kann endlich flüchten. Im Sarg. Dem letzten Käfig. Ort ohne Schmerz.“ Keinem anderen deutschen Filmemacher, weder davor noch danach, sind solche Worte je nachgerufen worden.
II.
Rainer Werner Fassbinder, geboren am 31. Mai 1945 in Bad Wörishofen, hinein geworfen in die unmittelbare Nachkriegszeit. „Wir wohnten in München“, erzählt seine Mutter, „es war kein Glas in den Fenstern, wir hatten nicht genug Heizmaterial. Da sagte der Vater, der Arzt war, er bringe das Kind zu seinem Bruder aufs Land, weil es in der Stadt den Winter nicht überleben würde. Sie müssen sich vorstellen, was es für eine Mutter bedeutet, wenn man ihr vier Monate nach der Geburt das Kind wegnimmt. Es war schrecklich.“ Es wird nicht die letzte Trennung sein: Als Fassbinder sechs ist, lassen sich die Eltern scheiden; der Onkel und die von ihm geliebte, von der Mutter gehasste Großmutter, aus Danzig vertrieben und für einige Zeit bei den Fassbinders untergeschlüpft, ziehen fort. Als er acht ist, erkrankt die Mutter an Tuberkulose; er muss ins Internat; auf seinem Wunschzettel ans Christkind steht an erster Stelle die Bitte, sie möge schnell wieder gesund werden.
Viel später wird er ihre Nähe immer wieder suchen, besetzt sie seit „Götter der Pest“ (1969) in fast jedem seiner Filme, nennt sie beim Drehen Mutti, Lilo oder Frau Eder. In kritischen Situationen sagt er: „Sie“.
III.
Frauen und Männer. Zerstörerische Frauen, zerstörte Männer, und umgekehrt. Nichts ist gut zwischen den Geschlechtern. Dem vermeintlichen Glück folgt immer der Verrat. Lügen aus Verlegenheit, Angst, Feigheit, Bosheit, weil man nicht anders kann und weil man nichts anderes gelernt hat; Lüge als Bindemittel der Familie, als Kleister der Gesellschaft. Die kleinste Zelle als Spiegel des großen Ganzen. Ein Sammelsurium von Lügen, das sich als Demokratie geriert. Filme, die Titel tragen wie „Liebe ist kälter als der Tod“ (1969), „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ (1972), „Satansbraten“ (1976) oder „Ich will doch nur, dass ihr mich liebt“ (1976). Mit all seinen Arbeiten dringt Rainer Werner Fassbinder zur inneren Verfasstheit der Bundesrepublik vor, zu ihren Wurzeln, Kontinuitäten und Brüchen, ihren Tabus. Sittengeschichte als Zeit- und Politikgeschichte. Ein deutscher Enkel von Balzac und Zola. Am Ende seines Films „Die Ehe der Maria Braun“ (1978) verknüpft Fassbinder das Private ganz direkt mit dem Gesellschaftlichen. Als Negativbilder lässt er eine Galerie der Kanzler ablaufen: Adenauer, Erhard, Kiesinger, dann Helmut Schmidt. Willy Brandt fehlt. Brandt, der Emigrant, der manchen Deutschen ähnlich fremd vorgekommen sein muss, wie sie in Fassbinder einen Fremden, einen Nestbeschmutzer sahen: sein Fehlen im Film als Verbeugung vor einer Art Bruder im Geiste.
IV.
Zwischen 1965 und 1982 entstehen mehr als 50 Filme, Fernsehserien, Theaterstücke, Hörspiele. Leben als Arbeit. Arbeit als Rausch. Arbeiten, um zu überleben. Überleben, um zu arbeiten. Jeder Film dreht dem Tod eine lange Nase. „Täglich erwarte ich einen Todesstoß, wenn ich auch hoffe, dass man sich meiner erbarmt“, hat schon der 14-Jährige in einem Schulaufsatz geschrieben. Fassbinders Produktivität beginnt mit dem Sehen von Filmen, bereits als Kind zwei, drei am Tag. Bald ist es kein passives Herunterschlucken mehr, sondern aktives Entdecken. Douglas Sirk und dessen Melodramen. Howard Hawks’ verdeckt schwule Männergeschichten. Jean-Pierre Melvilles düstere Krimis. Raoul Walshs Western. Jean-Luc Godards „Außer Atem“. Sehen als Sog. Sehen auch, um zu erkennen, wie Kunstwirklichkeiten entstehen. Wie Räume gebaut sind. Wie Montage neue Zusammenhänge erschafft. Wie Joseph von Sternberg das Licht setzt, um Marlene Dietrich zum Vamp zu machen. Später, in „Lili Marleen“ (1980) oder in „Lola“ (1981), wird Fassbinder ein ähnliches Licht benutzen, um Hanna Schygulla und Barbara Sukowa als Stars zu etablieren.
Nicht nur Fassbinder, alle Regisseure seiner Generation tauchen in die Filmgeschichte ein, nicht zuletzt um zu lernen, in welche Formen ihre eigenen Fabeln gegossen werden müssen. Film ist Stoff, Thema und Form zugleich. Vielleicht ist Film vor allem Form? Welche jungen Regisseure kennen heute noch das Kino Melvilles? Antonionis? De Sicas? Ophüls’? Buñuels? Ozus? Und Fassbinders? Fängt Filmgeschichte für viele nicht erst bei Quentin Tarantino an, bestenfalls mit einer Prise Kubrick und Scorsese gewürzt? Sehen neue deutsche Filme nicht oft auch deshalb so beliebig aus, weil die alten höchstens als historische Information zur Kenntnis genommen werden?
V.
Die Räume. Außenwelten interessieren Fassbinder fast nie. Er baut sich seine stilisierte Welt im Atelier. Erdrückende Wände und Decken. Gruften und Gefängnisse, die sich auf den ersten Blick als bürgerliche oder kleinbürgerlich-heimelige Wohnungen tarnen. Dazu umkreist die Kamera (von Dietrich Lohmann und Jürgen Jürges, Michael Ballhaus oder Xaver Schwarzenberger geführt) die Figuren, fesselt sie, zwängt sie ein. Manchmal, schreibt Wilfried Wiegand, „leben die Menschen wie exotische Fische in einem Aquarium. Wir betrachten sie wie durch eine Glaswand, die sie selber nicht zu bemerken scheinen, bis einige von ihnen sie dann eines Tages doch erkennen und ahnen, dass da draußen, jenseits der Scheibe, das eigentliche, das wirkliche Leben sein muss.“ Auch Stadtlandschaften mutieren zu Gefängnissen, die bayerische Vorstadt in „Katzelmacher“ (1969), die im Studio nachempfundene Metropole in „Berlin Alexanderplatz“ (1980). Ein Gefängnis kann die Zugehörigkeit zu einer Familie, einer Gruppe, einer Schicht, einer Klasse, einer Religion, einer Hautfarbe sein. Die deutsche Putzfrau Emmi und der marokkanische Arbeiter Ali lösen in „Angst essen Seele auf“ (1973) ihre getrennten Zellen auf und sitzen dann doch nur in einer gemeinschaftlichen.
Jeder ist für sich, Gott ist gegen alle. Gegen „Effi Briest“ (1974), die es nie gelernt hat, sich für ein Leben außerhalb ihres Standeskonventionen zu öffnen, und die daran zugrunde geht. Gegen den Bahnhofsvorsteher „Bolwieser“ (1977), der seiner und seiner Umgebung Kleinbürgerlichkeit zum Opfer fällt.
Ihr Dilemma drückt Fassbinder immer wieder durch ihre Unfähigkeit zu kommunizieren aus. Schon in „Katzelmacher“ (1969), dem vierten Film und ersten großen Erfolg des Regisseurs, sind die Figuren in ihren Sprachfloskeln gefangen. Plappern, ohne etwas zu sagen. Oder Schweigen. Als einzige Tat, schreibt Georg Seeßlen, mit der viele Figuren Fassbinders noch auf sich aufmerksam machen könnten, blieben Mord und Selbstmord: „Der Vater muss umgebracht werden, die Mutter provoziert, das Kind zu ermorden; der Geliebte wird erst in seinem Tod erkannt. Der Doppelgänger, der Bruder, das Spiegelbild muss getötet werden.“ Das Verbrechen als Schrei um Hilfe, als Zerreißen des Kokons, in dem das Leben erstickt.
VI.
In seinen ersten Filmen skizziert Fassbinder das von ihm entworfene Bild des bundesdeutschen Alltags weitgehend kühl und distanziert. Seine Schauspieler, viele davon aus dem legendären, von ihm geleiteten Münchner „antiteater“, wenden in Sprachduktus, Gesten, Haltungen Verfremdungseffekte an, die bisweilen an Brecht, auf jeden Fall an Marieluise Fleißer erinnern. Mit dem Einsatz älterer, erfahrener Darsteller ändern sich Bild und Ton: Brigitte Mira in „Angst essen Seele auf“, Luise Ullrich und Werner Finck in „Acht Stunden sind kein Tag“ (1972). Als Rudolf Platte und Johanna Hofer in „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ (1982) zu sehen sind, dem letzten Film, der zu Fassbinders Lebzeiten uraufgeführt wird, sind die Distanzen längst mit Gefühlen untersetzt: Aus der radikalen Kälte wächst radikale Liebe, radikale Verzweiflung, radikaler Zorn.
Spätestens Ende der 1970er-Jahre hat Fassbinder seine Stars der ersten Generation – Hanna Schygulla, Kurt Raab, Ulli Lommel, Margit Carstensen, Harry Baer, Hark Bohm, Ingrid Caven, Irm Herrmann – mit denen der zweiten fest liiert: Adrian Hoven, Karlheinz Böhm, Gisela Uhlen. Bernhard Wicki, Mario Adorf, Wolfgang Kieling und Eddie Constantine treten bei ihm auf, auch Armin Mueller-Stahl und Hilmar Thate, die aus der DDR kommen und noch einen neuen Tonfall in die Filme bringen. Gemeinsam mit ihnen geht Fassbinder mehr und mehr auf die Zuschauer zu, ein Weg, auf dem er (fast) jeden, den er braucht und der es selbst will, mitzunehmen bereit ist. Andere Regisseure seiner Generation haben die Alt-Stars abgeschrieben und mitsamt „Papas Kino“ zu den Akten gelegt. Er dagegen entdeckt, dass die Kunstwelten seines Kinos mit ihnen professionell bestens zu erschaffen sind. Er verknotet die 1940er- und 1950er- mit den 1970er-Jahren: inhaltlich, stilistisch, personell. Er zitiert, ironisiert und konterkariert, spielt mit Versatzstücken und erfindet neue hinzu, ist einmal sogar komisch („Lola“).
Filmen ist für Fassbinder nie ein Wiederkäuen bewährter Mittel und Methoden, sondern ewiger Versuch, ständiger Neubeginn. Die Dialektik von Vergehen und Werden, Ablegen und Bewahren. Mit dem Mut zum Risiko. Zum Irrtum. Zur Niederlage, die noch nicht einmal eingetreten sein muss, wenn schon der nächste Stoff ins Atelier geht.
VII.
Film muss sein. Wenn es keine Förderung gibt, wird eben mit jenem Geld gedreht, das gerade vorhanden ist. Der Freundeskreis, in dem Fassbinder lebt und in dessen Zentrum er steht, macht das möglich. Innerer Druck und äußere Impulsivität, so lange es irgend geht. Fassbinder nimmt sich die Freiheit, stets aufs Neue „Ich“ zu sagen: „Ich sehe, fühle, denke so.“ Radikale Subjektivität, bis hin zur verzweifelten Selbstentblößung in „Deutschland im Herbst“ (1978), mit eruptiven Aggressionsschüben gegen sich, den Lebensgefährten, die Mutter. Jetzt geht es nicht mehr ums Kino, jetzt geht es ums Ganze. Auf die Gefährdung der Demokratie durch die Instrumente der Macht reagiert Fassbinder mit einer Momentaufnahme seiner Ängste und Ausweglosigkeit. Er wirft alles in die Waagschale. Nie hat sich ein deutscher Regisseur so schonungslos auf der Leinwand offenbart.
Feinde und wohl auch Freunde unterstellen ihm bisweilen eine intellektuelle Nähe zu Terroristen. Aber waren nicht schon jene Sozialrevolutionäre der „Niklashauser Fart“ (1970) zum Scheitern verurteilt gewesen, die Fassbinder in eine Szenerie zwischen europäischem Mittelalter und modernem Lateinamerika agieren ließ? In „Die Dritte Generation“ (1979) zeigt er nur ein Jahr nach „Deutschland im Herbst“, was von vermeintlichen Revolutionäre übrig blieb. Er verabschiedet sie mit einer grellen, respektlosen und doch auch traurigen Farce – so wie er den Funktionären der westdeutschen Kommunistischen Partei auf die Füße tritt, als er sie in „Mutter Küsters Fahrt zum Himmel“ (1975) als spießige Verführer präsentiert. Utopie hat bei Fassbinder nichts mit Ideologie zu tun, sondern mit praktizierter Menschlichkeit.
Nie lässt er sich festlegen, kaum vereinnahmen. Für „Die Dritte Generation“ bekommt er keinen Pfennig Fördergeld, auch der WDR lehnt eine Beteiligung ab; Fassbinder produziert auf eigenes Risiko. Für die folgende Reihe „Berlin Alexanderplatz“ mit ihren 13 Teilen stehen ihm 13 Mio. Mark zur Verfügung. Dann stattet ihn der konservative Alt-Produzent Luggi Waldleitner für „Lili Marleen“ mit elf Mio. aus, dem bis dahin höchsten Budget eines deutschen Films überhaupt. Und viele schütteln die Köpfe. „Faschismus-Abziehbilder: Exportschlager fürs Kino“ titelt eine linke Wochenzeitung, die ihn ein Jahr später, für „Lola“ und die darin artikulierte Kritik an der restaurativen Ära Adenauers, sofort wieder umwirbt. Nach „Querelle“ (1982), seinem letzten, posthum aufgeführten Opus mit Jeanne Moreau und Franco Nero, einer schwulen Liebes- und Rachegeschichte in streng stilisierten Dekors, steht ein Film über die 1918 ermordete Kommunistin Rosa Luxemburg auf der Agenda.
Das Verstörende, das von Fassbinder ausgeht, regt immer auch Andere an. Wolfram Schütte in seinem Nachruf: „Wenn man sich den Neuen deutschen Film allegorisch als Menschen imaginierte, so wäre Kluge sein Kopf, Herzog sein Wille, Wenders sein Auge, Schlöndorff seine Hände und Füße; aber Fassbinder wäre sein Herz gewesen.“ Doch was ist, wenn das Herz aussetzt? Tatsächlich dauerte es nicht mehr lang, bis sich Mehltau über den westdeutschen Film legte. Sicher hatte das mit jener Sattheit und Zufriedenheit zu tun, die von Kohl genährt wurde und als filmischen Ausdruck eine affirmative Lustspielwoge erzeugte. Was hätte Fassbinder wohl dagegen gesetzt, vor und erst recht nach der deutschen Einheit? Der frühe Verlust wiegt bis heute schwer.
VIII.
Ich konnte ihn nie leiden, sagt Rosa von Praunheim. Und dreht einen zärtlichen Film über ihn. Andere, die ihn nie leiden konnten, schütten nach seinem Tod Schmutz über ihn aus. Jetzt scheint, wie schon manchmal vorher, die Zeit gekommen draufzuschlagen: das unrasierte homosexuelle Früchtchen in Jeans und Lederjacke, das seine Mitarbeiter tyrannisierte, Rauschgift, Schnaps und 60 Zigaretten am Tag konsumierte. Das wilde, ungebärdige Kind, das seine Verletzlichkeit sublimierte, indem es andere verletzte. Manche Hasstiraden können nur ungenügend kaschieren, dass solchen Schreibern Fassbinders ganze Richtung nicht passte, seine Kritik an den Zuständen, sein Infragestellen bürgerlicher Institutionen. Die Ablehnung des Äußeren, die Fassbinder mitunter bewusst provozierte – in seinen Anfangsjahren hatte er bei Schlöndorff Brechts „Baal“ gespielt – , meinte oft genug vor allem den politisch-moralischen Kern der Filme.
Heute, 23 Jahre nach seinem Tod, bleiben „nur“ diese Filme. Wenn sie denn zu sehen sind. Eine nahezu komplette Retrospektive, so wie sie 1992 zusammen mit einer Ausstellung in Berlin stattfand, ist hierzulande kaum noch denkbar. Nicht mehr zu bezahlen, die Rechte zu teuer, die Kosten für neue Kopien zu hoch. Vielleicht wissen die Deutschen einfach noch nicht, dass Fassbinder längst in jenem Olymp angekommen ist, in dem auch Sirk, Ophüls, Ozu thronen. Und dass er dort vermutlich darauf wartet, von jungen Zuschauern wieder herab geholt und in die Arme genommen zu werden. Denn seine Filme werden gebraucht: ihre Menschlichkeit, ihr Mut, ihr Rigorismus, ihr ungebärdiger Stil, ihre Unangepasstheit, der glasklare Blick auf die Dinge. Vielleicht würde Rainer Werner Fassbinder dann endlich in jener Familie ankommen, nach der er sich ein Leben lang verzehrt hat.
|
|
|
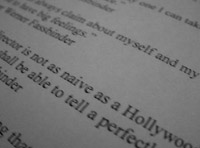 |