 |
| |
Berlin, 05.06.1992
Die Dialektik der Pflastersteine
Zur großen Fassbinder-Ausstellung am Alexanderplatz / Von Helmut Böttiger
Frankfurter Rundschau |
Das Dämonische wirkt nach. Dass Rainer Werner Fassbinder eine Gruppe um sich zusammenschweißen und auf sich fixieren konnte, wurde sogar auf einer Show-Medienveranstaltung im Berliner Grand Hotel anlässlich der Werkschau zum zehnten Todestag deutlich. Obwohl sie fast keine Zeit gehabt hatten, die Ausstellung auf dem Alexanderplatz zu sehen, ständig unzählige Kamerateams mit unzähligen Kabelträgern, Mikrophonhaltern und Beleuchtern die engen Wege versperrten und die Lebensdokumente Fassbinders verdeckten, so waren doch Elisabeth Trissenaar, Irm Hermann, Hanna Schygulla und andere aus Fassbinders Team von der direkten Konfrontation mit der Fassbinder-Atmosphäre sichtlich berührt; Volker Schlöndorff gar konnte kaum mehr seine Stimme bändigen.
Der kurze zeitliche Abstand ist dabei wohl das Irritierende, ein Abstand jedoch, der durch die Erfahrung so unendlich weit geworden zu sein scheint. Die 70er sind zentrale Jahre für die Biographien der Fassbinder-Generation. Doch wie fern scheinen diese Produktionsbedingungen zu sein, dieser künstlerische Furor, diese Verschmelzung von Arbeit und Leben. Wim Wenders konstatierte trocken: „Diese Zeit, in der einer so phantastisch arbeiten konnte, gibt es heute nicht mehr.“ Das ist die Oberseite der Gefühle. Die Begegnung mit Fassbinder, der für bestimmte künstlerisch-gesellschaftliche Möglichkeiten der Bundesrepublik steht, mutet heute, zehn Jahre nach seinem Tod am 10. Juni 1982, geradezu gespenstisch an.
Berlin ist die Hauptstadt der ihm gewidmeten Retrospektiven, die zur Zeit an vielen Orten stattfinden. Die „Werkschau Rainer Werner Fassbinder – Dichter, Schauspieler, Filmemacher“ ist umfassend. Sie zeigt an drei verschiedenen Orten alle seine Filme und noch viele darüber hinaus und bietet Gesprächsrunden mit Personen aus dem Umfeld. Harry Baer und Juliane Lorenz, die die Werkschau organisiert haben, stellten eine Ausstellung ins Zentrum: an einem film- und literaturgeschichtsträchtigen Ort, den Ausstellungshallen unterhalb des Fernsehturms am Alexanderplatz. Fassbinders große BERLIN ALEXANDERPLATZ-Anstrengung, seine Fernsehsuada, die viele Perspektiven seiner Arbeit in einem großen Versuch zusammenbringt, ist hier also an den Ort des Mythos zurückgekehrt – an einen nackten, kahlen Betonort, leergefegte Flächen, gesichtslose Bauten; hier stehen die Hinterlassenschaften des realen Sozialismus in einem seltsamen Sinn für die Realität selbst.
Rolf Zehetbauer, Ausstatter in vielen Filmen und Baumeister dieser Ausstellung, hat es geschafft, in dieses karge, aber raumgreifende Milieu die Fassbinder-Aura zu holen. Im Erdgeschoss der zweistöckigen Ausstellung erstreckt sich eine weite Monitorlandschaft, in der sich das gesamte Fassbinder-Oeuvre zu einem einzigen unverständlichen, zusammensprechenden Gefühl vereinigt: Auf jedem der mehr als hundert Geräte ist ein Ausschnitt aus der Gesamtproduktion Fassbinders zu sehen, ein unendliches optisch-akustisches Geflirre, in dem man sich zwar nicht auf ein Einzelwerk konzentrieren kann, aber gerade deshalb eine Vorstellung von den ästhetischen Dimensionen des Filmemachers erhält: die dissonante, schrille, aber dadurch in sich geschlossene Arbeit. Was hier als Lebenswerk jenes Mannes, der siebenunddreißigjährig starb, aufflimmert, ja aufflammt, braucht keine Worte mehr.
Fassbinder hat ein Leben wie im Zeitraffer geführt. Im oberen Stockwerk ist es in zwanzig Stationen nachgestellt, und der Zeitraffer scheint sich seltsam im Ablauf dieser Stationen zu wiederholen: die Fotos aus Kindheit und Jugend, handgeschriebene Zettel und frühe Dokumente schaffen einen dichten Eindruck, der sich jedoch immer mehr in unzählige Film- und Theaterplakate, Aktionen und Regieanweisungen auffächert. Die biographisch erkennbare Person geht völlig in der Arbeit auf und ist nur durch diese zu erfassen; kein Privatleben, nur ein einziger Film.
Heiner Müller bezeichnete es als Wesenszug des „Genies“ Fassbinder, dass dessen Kunst der Schnelligkeit des Denkens entsprach – das verzehrt, reißt die Existenz mit in den Strudel. Schon in einem kleinen Text des Vierzehnjährigen ist dieses Thema angeschlagen: „Ich bin der Schnittpunkt eines Dreiecks. Die beiden Geraden, die sich in mir schneiden, bilden einen stumpfen Winkel, der mir eigentlich viel Ausblick in die Zukunft gewähren sollte, aber meine Zukunft ist sehr unsicher. Kann doch selbst ein kleiner Schuljunge schon, wenn er einen Radiergummi besitzt, meine Zukunft in ein endloses Nichts versetzen. Täglich erwarte ich einen solchen Todesstoß, wenn ich auch hoffe, dass man sich meiner erbarmt (...)“
Der Antrieb zum ungestümen Schaffen, der Hintergrund für das Geflecht aus Alkohol, Arbeitsexzessen und Drogen, das Aufputschen des Körpers scheint bereits in dieser pubertären Selbstaussage durch („täglich erwarte ich einen solchen Todesstoß“). Beim Vierundzwanzigjährigen wirkt es bereits wie eine kalte Reflexion. Volker Schlöndorff erzählt in seinem Katalogbeitrag, wie der Versicherungsarzt vor der BAAL'-Verfilmung 1969 Fassbinder von der Arbeit abhalten wollte, im Filmgeschäft kommt das so gut wie nie vor – schwaches Herz, Übergewicht, zigarettenstrapazierte Lunge. Fassbinder jedoch „nahm seine Kondition nur als Bestätigung, dass die Zeit drängte. Er hatte viel vor“.
Die Ausstellung erklärt nicht, baut keinen didaktischen Rahmen; sie evoziert. Sie liefert dem, der die Fassbinder-Welt bereits kennt, atmosphärisches Material, das ihn bannt. Nicht nur durch die alte Arriflex, mit der KATZELMACHER gedreht wurde, oder den Regiestuhl mit den Initialen. Es gibt, vor allem aus der frühen Zeit, einige Entdeckungen. Der einzelne, der sich verzehrt, der egomanisch seine Lebensenergie herunterbrennt, tut das in der Zeit der 68er-Bewegung, der Zeit des Kollektivs und der Solidarität – diese Koordinaten führen zum eigentümlichen Fassbinder-Sound, der Fassbinder-Farbe.
Ein kleines Rundschreiben, das er während der Arbeit an der WARNUNG VOR EINER HEILIGEN NUTTE 1970 an die Gruppe schickte, steht dafür: das Team des „antieaters“ war ans Ende gekommen, das Prinzip der Kollektivität griff nicht, letztendlich fiel die Verantwortung allein auf Fassbinder zurück. Unter der Überschrift „Liebe Freunde und Genossen oder so“ appellierte er noch einmal an die Gruppe, krakelte mit Kugelschreiber über die Maschinenschrift, zentraler Begriff ist „Zärtlichkeit“. Der Rausch braucht die anderen, und die Gruppe wirkt wie ein Katalysator. Schwächen eines Films werden nicht lang an diesem überarbeitet, sondern die Diskussion geht gleich in den nächsten ein; finanziert wird der jeweilige Film vom Etat des nächsten – eine sich permanent überreizende Reaktion, an deren Ende die Selbstzerstörung steht.
Dass so jemand an den staatlichen Stellen vorbei arbeiten musste, ist klar, dass er von der Kulturbürokratie, von der anerkannten Ausbildung, von der vorgesehenen Förderung nicht wahrgenommen wurde. Zweimal, 1965 und 1967, hat sich Fassbinder an der Berliner Filmhochschule beworben, beide Male wurde er abgelehnt. Die Liste der Namen, die statt seiner angenommen wurden, wirkt heute wie eine Satire: Man kennt kaum einen mehr. Das sich in der Kulturgeschichte bis zum Überdruss wiederholende Trauma des Genies: dass es mit den Normen seiner Zeit nicht zu fassen ist.
Im Katalogbeitrag von Hans Helmut Prinzler ist die Geschichte dieser Bewerbungen nachzsulesen: Fassbinder quält sich im Fragebogen mit sogenannten allgemeinen Fragen, mit Bildungsvoraussetzungen herum, doch sobald es filmimmanent wird, ans Handwerk geht, sprudelt es aus ihm heraus. Solche Einseitigkeit, solche Monomanie ist gefährlich.
Heute sind die Normen andere. Nirgends wird das deutlicher als am geheimen Mittelpunkt der Ausstellung: der nachgestellten Wohnung Fassbinders. In den drei aneinandergereihten Zimmern ist nichts von der Coolness der achtziger Jahre, von Neon, Design und strengen kühlen Formen – ein einziger Hymnus auf die Wohngemeinschaft ist’s, auf das zusammengestoppelte Lebensgefühl der siebziger Jahre. Die Küche als Mittelpunkt, mit einer „Rainer“-Tasse oben im Regal, die Stimme Fassbinders spricht leise die Regieanweisungen zur DRITTEN GENERATION in den Raum – so, wie er es leibhaftig am langen Küchentisch machte, auf dem der Aschenbecher überquillt, vor der Spüle, die mit ihren Rückständen am Ausguss die Grenze zwischen der Fassbinder-Welt und dem Ausstellungsbesucher zieht.
Das Schlafzimmer ist hinter einem dunklen feinen Gazevorhang verborgen; neben der Matratze liegen malerisch verstreut Illustrierte herum, obenauf ein .Stern-Titel mit Romy Schneider. Romy, ein typisches Fassbinder-Melodram. Es ist konsequent, dass sie in der KOKAIN-Verfilmung, die er vorhatte, eine Hauptrolle spielen sollte. Das Melodram, Fassbinders Credo, setzt das unmittelbare Lebensgefühl um und steht in größtem Gegensatz zum Zynismus, der die intellektuelle Haltung nach Fassbinder prägt.
Die Wohnung wirkt wie eine Kulisse zu einem seiner Filme, eine Zeitstudie aus Trivialem, Kitsch und Mode, ein in sich stimmiges Ensemble, das den Besucher übermannt. Fassbinders Melodram: das Direkte, das sich vor dem Sentimentalen nicht scheut, ein Gefühlsüberschwall, in dem das Rauschhafte der Existenz ungeheure Geltung bekommt. Fassbinder hat Schauspieler, die durch ihre 50er-Jahre-Schinken für den Neuen Deutschen Film völlig desavouiert schienen, in seinen Filmen wieder beschäftigt: Wir sehen Glamourfotos von Brigitte Mira, Karlheinz Böhm, Adrian Hoven oder Barbara Valentin. Es seien großartige Schauspieler, weil sie nur in schlechten Filmen gespielt hätten, ist sein schlagender Kommentar. Er geht den Emotionen auf den Grund, kostet sie aus.
Die Ausstellung, die auf diskursive Texte verzichtet und nur Zitate Fassbinders zu den Exponaten stellt, versucht, diese Haltung zu beschwören. Der Raum mit den UFA- und 50er-Jahre-Revivals, MARIA BRAUN, LILI MARLEEN, LOLA, VERONIKA VOSS ist mit der atemberaubenden Schlusssequenz aus MARIA BRAUN beschallt, wo die Originalreportage Herbert Zimmermanns das Deutschland des Jahres 1954 skandiert und sein hysterisches „Deutschland ist Weltmeister“ auf die Gasexplosion des Hauses von Maria Braun zustöhnt.
Der ALEXANDERPLATZ in den Ausstellungshallen am Alexänderplatz ist dunkel, ein schwarzer Bretterverschlag mit Szenenfotos und Requisiten; in der Mitte des kleinen Raums, auf den die Gänge zulaufen, wirft ein Diaprojektor Standbilder an die Wand, sanft untermalt von der Stimme Fassbinders aus dem Kassettenrecorder. Minimal Art mit Pflastersteinen. Der Boden besteht aus schwarzen Pflastersteinen, die Zwanziger-Jahre-Evokation; Pflastersteine, die auch unten in der Monitorlandschaft mit den Filmen lose drapiert sind.
Der Pflasterstein hat heute etwas Anheimelndes, Dekoratives; die Alleen der Mark Brandenburg tauchen auf und denkmalgeschützte Stadtzonen. In der Zeit Fassbinders stand der Pflasterstein für etwas völlig anderes. Wie diesen Abstand ausmessen – ironisch, hilflos? Den Abstand aber überhaupt zu erkennen, dazu bietet diese Ausstellung unendliches Material.
Helmut Böttiger
|
|
|
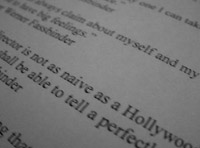 |